Quotes from book
The Birth of Tragedy
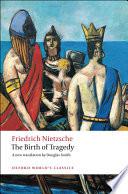
The Birth of Tragedy from the Spirit of Music is an 1872 work of dramatic theory by the German philosopher Friedrich Nietzsche. It was reissued in 1886 as The Birth of Tragedy, Or: Hellenism and Pessimism . The later edition contained a prefatory essay, "An Attempt at Self-Criticism", wherein Nietzsche commented on this earliest book.

Aber wie verändert sich plötzlich jene eben so düster geschilderte Wildniss unserer ermüdeten Cultur, wenn sie der dionysische Zauber berührt! Ein Sturmwind packt alles Abgelebte, Morsche, Zerbrochne, Verkümmerte, hüllt es wirbelnd in eine rothe Staubwolke und trägt es wie ein Geier in die Lüfte. Verwirrt suchen unsere Blicke nach dem Entschwundenen: denn was sie sehen, ist wie aus einer Versenkung an's goldne Licht gestiegen, so voll und grün, so üppig lebendig, so sehnsuchtsvoll unermesslich. Die Tragödie sitzt inmitten dieses Ueberflusses an Leben, Leid und Lust, in erhabener Entzückung, sie horcht einem fernen schwermüthigen Gesange - er erzählt von den Müttern des Seins, deren Namen lauten: Wahn, Wille, Wehe.
Ja, meine Freunde, glaubt mit mir an das dionysische Leben und an die Wiedergeburt der Tragödie. Die Zeit des sokratischen Menschen ist vorüber: kränzt euch mit Epheu, nehmt den Thyrsusstab zur Hand und wundert euch nicht, wenn Tiger und Panther sich schmeichelnd zu euren Knien niederlegen. Jetzt wagt es nur, tragische Menschen zu sein: denn ihr sollt erlöst werden. Ihr sollt den dionysischen Festzug von Indien nach Griechenland geleiten! Rüstet euch zu hartem Streite, aber glaubt an die Wunder eures Gottes!
Source: The Birth of Tragedy (1872), p. 98

“How far I was then from all that resignationism!”
Oh wie ferne war mir damals gerade dieser ganze Resignationismus!
"Attempt at a Self-criticism", p. 10
The Birth of Tragedy (1872)

Es geht die alte Sage, dass König Midas lange Zeit nach dem weisen Silen, dem Begleiter des Dionysus, im Walde gejagt habe, ohne ihn zu fangen. Als er ihm endlich in die Hände gefallen ist, fragt der König, was für den Menschen das Allerbeste und Allervorzüglichste sei. Starr und unbeweglich schweigt der Dämon; bis er, durch den König gezwungen, endlich unter gellem Lachen in diese Worte ausbricht: `Elendes Eintagsgeschlecht, des Zufalls Kinder und der Mühsal, was zwingst du mich dir zu sagen, was nicht zu hören für dich das Erspriesslichste ist? Das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar: nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich - bald zu sterben.
Source: The Birth of Tragedy (1872), p. 22

Nun aber schien Sokrates die tragische Kunst nicht einmal "die Wahrheit zu sagen": abgesehen davon, dass sie sich an den wendet, der "nicht viel Verstand besitzt", also nicht an den Philosophen: ein zweifacher Grund, von ihr fern zu bleiben. Wie Plato, rechnete er sie zu den schmeichlerischen Künsten, die nur das Angenehme, nicht das Nützliche darstellen und verlangte deshalb bei seinen Jüngern Enthaltsamkeit und strenge Absonderung von solchen unphilosophischen Reizungen; mit solchem Erfolge, dass der jugendliche Tragödiendichter Plato zu allererst seine Dichtungen verbrannte, um Schüler des Sokrates werden zu können.
Source: The Birth of Tragedy (1872), p. 68

Bei diesem Zusammenhange ist die leidenschaftliche Zuneigung begreiflich, welche die Dichter der neueren Komödie zu Euripides empfanden; so dass der Wunsch des Philemon nicht weiter befremdet, der sich sogleich aufhängen lassen mochte, nur um den Euripides in der Unterwelt aufsuchen zu können: wenn er nur überhaupt überzeugt sein dürfte, dass der Verstorbene auch jetzt noch bei Verstande sei.
Source: The Birth of Tragedy (1872), p. 55

Mit dem Tode der griechischen Tragödie dagegen entstand eine ungeheure, überall tief empfundene Leere; wie einmal griechische Schiffer zu Zeiten des Tiberius an einem einsamen Eiland den erschütternden Schrei hörten "der grosse Pan ist todt": so klang es jetzt wie ein schmerzlicher Klageton durch die hellenische Welt: "die Tragödie ist todt! Die Poesie selbst ist mit ihr verloren gegangen! Fort, fort mit euch verkümmerten, abgemagerten Epigonen! Fort in den Hades, damit ihr euch dort an den Brosamen der vormaligen Meister einmal satt essen könnt!"
Source: The Birth of Tragedy (1872), p. 54

In diesen Sanct-Johann- und Sanct-Veittänzern erkennen wir die bacchischen Chöre der Griechen wieder, mit ihrer Vorgeschichte in Kleinasien, bis hin zu Babylon und den orgiastischen Sakäen. Es giebt Menschen, die, aus Mangel an Erfahrung oder aus Stumpfsinn, sich von solchen Erscheinungen wie von "Volkskrankheiten", spöttisch oder bedauernd im Gefühl der eigenen Gesundheit abwenden: die Armen ahnen freilich nicht, wie leichenfarbig und gespenstisch eben diese ihre "Gesundheit" sich ausnimmt, wenn an ihnen das glühende Leben dionysischer Schwärmer vorüberbraust.
Source: The Birth of Tragedy (1872), p. 17

Nochmals gesagt, heute ist es mir ein unmögliches Buch, - ich heisse es schlecht geschrieben, schwerfällig, peinlich, bilderwüthig und bilderwirrig, gefühlsam, hier und da verzuckert bis zum Femininischen, ungleich im Tempo, ohne Willen zur logischen Sauberkeit, sehr überzeugt und deshalb des Beweisens sich überhebend, misstrauisch selbst gegen die Schicklichkeit des Beweisens, als Buch für Eingeweihte, als "Musik" für Solche, die auf Musik getauft, die auf gemeinsame und seltene Kunst-Erfahrungen hin von Anfang der Dinge an verbunden sind, als Erkennungszeichen für Blutsverwandte in artibus, - ein hochmüthiges und schwärmerisches Buch, das sich gegen das profanum vulgus der "Gebildeten" von vornherein noch mehr als gegen das "Volk" abschliesst, welches aber, wie seine Wirkung bewies und beweist, sich gut genug auch darauf verstehen muss, sich seine Mitschwärmer zu suchen und sie auf neue Schleichwege und Tanzplätze zu locken.
"Attempt at a Self-Criticism", p. 5
The Birth of Tragedy (1872)

“Art is the supreme task and the truly metaphysical activity in this life…”
Diesen Ernsthaften diene zur Belehrung, dass ich von der Kunst als der höchsten Aufgabe und der eigentlich metaphysischen Thätigkeit dieses Lebens im Sinne des Mannes überzeugt bin, dem ich hier, als meinem erhabenen Vorkämpfer auf dieser Bahn, diese Schrift gewidmet haben will.
"Preface to Richard Wagner", p. 13
The Birth of Tragedy (1872)

“We cannot help but see Socrates as the turning-point, the vortex of world history.”
Source: The Birth of Tragedy (1872), p. 73
Context: We cannot help but see Socrates as the turning-point, the vortex of world history. For if we imagine that the whole incalculable store of energy used in that global tendency had been used not in the service of knowledge but in ways applied to the practical — selfish — goals of individuals and nations, universal wars of destruction and constant migrations of peoples would have enfeebled man's instinctive zest for life to the point where, suicide having become universal, the individual would perhaps feel a vestigial duty as a son to strangle his parents, or as a friend his friend, as the Fiji islanders do: a practical pessimism that could even produce a terrible ethic of genocide through pity, and which is, and always has been, present everywhere in the world where art has not in some form, particularly as religion and science, appeared as a remedy and means of prevention for this breath of pestilence.

Source: The Birth of Tragedy (1872), p. 15
Context: Thus the man who is responsive to artistic stimuli reacts to the reality of dreams as does the philosopher to the reality of existence; he observes closely, and he enjoys his observation: for it is out of these images that he interprets life, out of these processes that he trains himself for life. It is not only pleasant and agreeable images that he experiences with such universal understanding: the serious, the gloomy, the sad and the profound, the sudden restraints, the mockeries of chance, fearful expectations, in short the whole 'divine comedy' of life, the Inferno included, passes before him, not only as a shadow-play — for he too lives and suffers through these scenes — and yet also not without that fleeting sense of illusion; and perhaps many, like myself, can remember calling out to themselves in encouragement, amid the perils and terrors of the dream, and with success: 'It is a dream! I want to dream on!' Just as I have often been told of people who have been able to continue one and the same dream over three and more successive nights: facts which clearly show that our innermost being, our common foundation, experiences dreams with profound pleasure and joyful necessity.